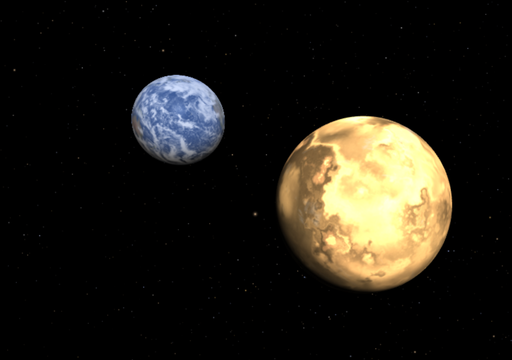Rätselhafte Einzelgänger: Darum kommen manche Tiere in Isolation besser zurecht
Während einige Tierarten unter Einsamkeit leiden, haben manche Lebewesen erfolgreich Strategien für das Alleinsein entwickelt. Die Forschung über Einzelgänger könnte auch für den Menschen relevant sein.

Viele soziale Tierarten leiden unter Einsamkeit: Trennung von Artgenossen kann bei ihnen Stress auslösen, Angstzustände verstärken und sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Doch nicht alle Tiere sind auf Gemeinschaft angewiesen. Einige Arten haben sich perfekt an ein Leben als Einzelgänger angepasst. Sie zeigen, dass Unabhängigkeit ebenso erfolgreich sein kann wie enge soziale Bindungen.
Ein Extrembeispiel etwa sind Blindmaulwürfe aus dem südlichen Europa und dem Nahen Osten. Anstatt Gesellschaft zu suchen, geraten sie unter Stress, sobald sie sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, selbst wenn eine Barriere zwischen ihnen steht.
Besonders kleinere Individuen leiden unter der Nähe anderer. „Sie können an dem Stress sterben, den sie haben“, erklärt Tali Kimchi, Verhaltensneurologin am Weizmann-Institut in Israel. Nachdem die Mütter sie aus dem elterlichen Tunnel vertrieben haben, leben solche Tiere ihr gesamtes Erwachsenenleben allein. „Es klingt komisch, aber das ist das Überleben dieser Kreaturen“, so Kimchi.
Wenn Einzelgänger doch Gesellschaft suchen
Nicht alle Tiere, die als Einzelgänger gelten, meiden Artgenossen vollständig. Manche tolerieren ihre Nähe, wenn es vorteilhaft ist. Busch-Karoo-Ratten etwa leben meist allein, kooperieren aber gelegentlich mit Verwandten. Sie teilen Futterstellen und bauen in Zeiten großer Nachfrage sogar gemeinsam Vorratshütten.
Verhaltensökologe Carsten Schradin vom Centre National de Recherche Scientifique in Straßburg, Frankreich.
Auch Kraken galten lange als radikale Einzelgänger, doch Forschungen zeigen, dass sie gelegentlich Gemeinschaften bilden: In der Jervis Bay in Australien hat sich eine Gruppe von bis zu 16 Düsteren Kraken an einem einzigen Ort angesiedelt. Der Ursprung dieser „Krakenstadt“ liegt vermutlich in der Ansammlung von Muschelschalen, die einen stabilen Untergrund für neue Bauten bildeten.

Hier entwickeln die Tiere ungewöhnliche soziale Verhaltensweisen: Männchen versuchen, Weibchen in der Nähe zu halten, konkurrieren miteinander und vertreiben Rivalen aus deren Höhlen. Manchmal schleudern sie mit ihren Trichtern gezielt Trümmer auf Nachbarn, ein Verhalten, das Wissenschaftler als „Drängeln“ bezeichnen.
Was wir daraus lernen können
Obwohl viele Einzelgänger unabhängig agieren, sind sie keineswegs unsozial. Forscher beobachten immer wieder, dass auch diese Tiere voneinander lernen. Rotfußschildkröten etwa, die allein nach Nahrung suchen, schauten sich in Experimenten Strategien bei Artgenossen ab. Diese Fähigkeit des sozialen Lernens galt lange als Merkmal von Gruppenlebewesen. Nun zeigt sich, dass auch Einzelgänger komplexe Formen der Informationsweitergabe nutzen.
Verhaltensökologe Carsten Schradin vom Centre National de Recherche Scientifique in Straßburg, Frankreich.
Die Forschung über Einzelgänger könnte nicht nur das Verständnis der Tierwelt erweitern, sondern auch für den Menschen relevant sein. Kimchi untersucht etwa, wie sich das Gehirn von Maulwurfsratten in Phasen verändert, in denen sie von sozialen Interaktionen zur Isolation übergehen. Solche Erkenntnisse könnten helfen zu verstehen, warum manche Menschen soziale Rückzüge erleben.
Gleichzeitig zeigen die Tiere, dass Alleinsein nicht automatisch problematisch ist. „Soziale Einzelgänger“ pflegen lose Netzwerke, interagieren punktuell mit anderen und bleiben dennoch unabhängig. „Alleinsein kann für viele Menschen ebenfalls die beste Wahl sein“, sagt Verhaltensbiologe Schradin. Ein Leben ohne ständige soziale Interaktion ist nicht weniger wertvoll – es ist einfach eine andere Strategie, die in der Natur ebenso erfolgreich sein kann wie das Leben in Gemeinschaften.
Quellenhinweis:
Makuya, L., & Schradin, C. (2024): Costs and benefits of solitary living in mammals. Journal of Zoology 323, 1, 9–18. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.13145
Kashash, Y., Smarsh, G., Zilkha, N., Yovel, Y., Kimchi, T. (2022): Alone, in the dark: The extraordinary neuroethology of the solitary blind mole rat. eLife 11:e78295. https://doi.org/10.7554/eLife.78295