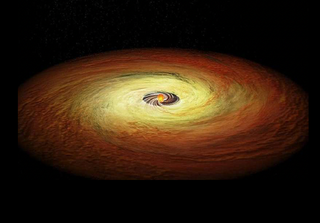Was, wenn es kein Leben auf anderen Planeten gibt? Wissenschaftler berechnen, wie viele Exoplaneten uns das sagen werden
Mithilfe fortschrittlicher statistischer Instrumente untersuchen die Forscher, wie selbst ein "Misserfolg" bei der Suche nach Leben wichtige Antworten auf unsere Position im Kosmos geben könnte.
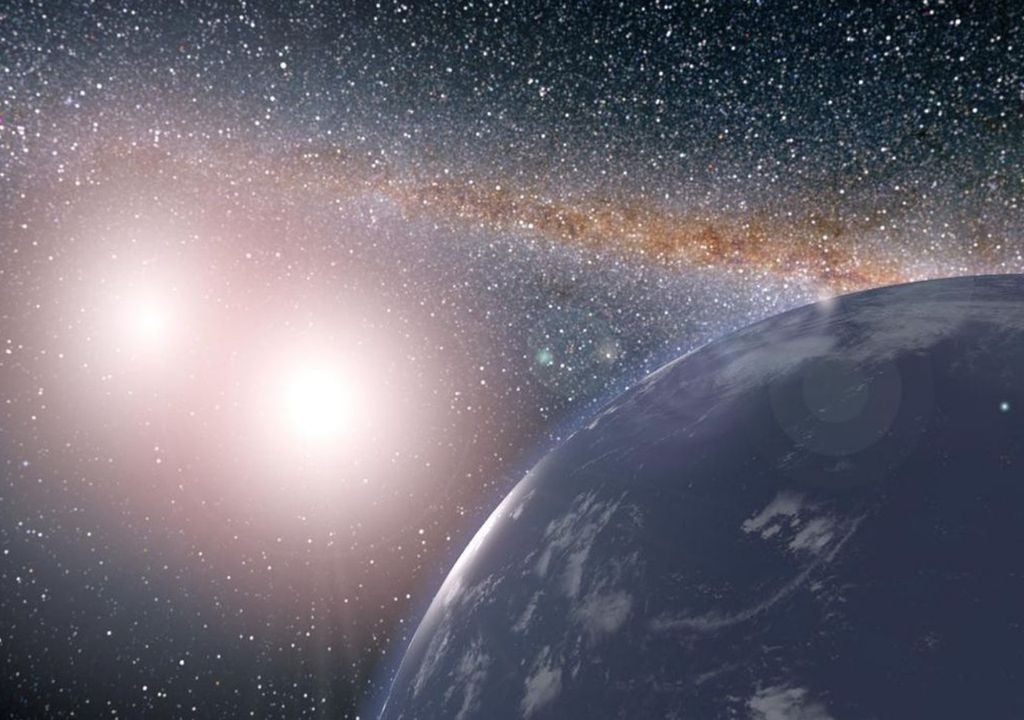
Was würde passieren, wenn sich das Universum nach Jahrzehnten der Erforschung als völlig still erweisen würde? Diese Frage motivierte eine Gruppe von Forschern um Dr. Daniel Angerhausen, Physiker an der ETH Zürich und Mitglied des SETI-Instituts, eine Studie zu entwickeln, die kürzlich im Astronomical Journal veröffentlicht wurde.
Das Team, das im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts Schweiz (PlanetsS) arbeitet, analysierte mit Hilfe eines Bayes'schen statistischen Ansatzes ein Szenario, das nur selten ernsthaft in Betracht gezogen wird: Ein Szenario, in dem keine Anzeichen von Leben auf anderen Welten entdeckt werden.
In einer Galaxie wie der Milchstraße wären das immer noch Milliarden von potenziell bewohnbaren Planeten... aber ohne nachweisbare Anzeichen von Leben.
Scheitern? Nicht unbedingt
Die Autoren der Studie sind keineswegs enttäuscht, sondern behaupten, dass ein solches Ergebnis einen enormen wissenschaftlichen Wert haben könnte . Die Festlegung einer zuverlässigen "Obergrenze" für die Häufigkeit bewohnter Welten wäre an sich schon ein bedeutender Fortschritt.
Es handelt sich um eine Schätzung, die bis jetzt außerhalb der Reichweite der Wissenschaft lag. Die Forscher warnen jedoch, dass die Interpretation solcher Daten mit äußerster Vorsicht erfolgen muss. "Es geht nicht nur darum, wie viele Planeten wir beobachten, sondern darum, die richtigen Fragen zu stellen und abzuschätzen, wie viel Vertrauen wir in die Ergebnisse haben können", erklärt Angerhausen.
Astronomische Beobachtungen, wie ausgefeilt sie auch sein mögen, sind mit Unsicherheiten behaftet. Einige rühren von der Schwierigkeit her, die Daten richtig zu interpretieren, was zu falsch-negativen Ergebnissen führen kann. Andere ergeben sich aus Verzerrungen bei der Auswahl der beobachteten Planeten, die möglicherweise nicht repräsentativ für die Gesamtpopulation sind.
Vorbereitungen für die LIFE-Mission
Diese Erkenntnisse sind vor allem für künftige Missionen wie das ehrgeizige LIFE-Projekt (Large Interferometer for Exoplanets) relevant, eine internationale Zusammenarbeit, die ebenfalls von der ETH Zürich geleitet wird. LIFE plant, die Atmosphären von Dutzenden von Exoplaneten auf chemische Signaturen zu untersuchen, die mit Leben vereinbar sind, wie etwa Wasserdampf, Sauerstoff und Methan.

Angerhausen und sein Team sind der Meinung, dass die Anzahl der Exoplaneten, die LIFE beobachten will, ausreicht, um statistisch signifikante Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie betonen jedoch, dass es selbst mit der fortschrittlichsten Technologie entscheidend sein wird, Unsicherheiten und potenzielle Verzerrungen sorgfältig zu quantifizieren. Daher schlägt die Studie vor, von vagen Fragen wie "Wie viele Planeten haben Leben?" zu konkreteren und messbaren Fragen überzugehen, z. B: "Welcher Anteil der Gesteinsplaneten in bewohnbaren Zonen zeigt deutliche Anzeichen von Wasser und Sauerstoff?"
Zwei Ansätze, eine komplementäre Vision
Die statistische Analyse der Studie wurde mit zwei Paradigmen durchgeführt: Bayesianisch und frequentistisch. Mitautorin Emily Garvin, Doktorandin in Quanz' Gruppe, leitete den frequentistischen Ansatz, der zur Gegenüberstellung und Validierung der Ergebnisse diente. "Wir neigen dazu, diese Methoden als gegensätzlich zu betrachten, aber in Wirklichkeit bieten sie komplementäre Perspektiven", bemerkt sie.
Letztendlich präsentiert die Forschung nicht nur ein faszinierendes Szenario (das der kosmischen Stille), sondern bietet auch konkrete Instrumente, um es mit wissenschaftlicher Strenge anzugehen. Denn selbst wenn es keine Signale gibt, hat das Universum viel zu sagen.
Quellenhinweis:
Angerhausen, D. et al. What if We Find Nothing? Bayesian Analysis of the Statistical Information of Null Results in Future Exoplanet Habitability and Biosignature Surveys. The Astronomical Journal (2025). external pageDOI: 10.3847/1538-3881/adb96d